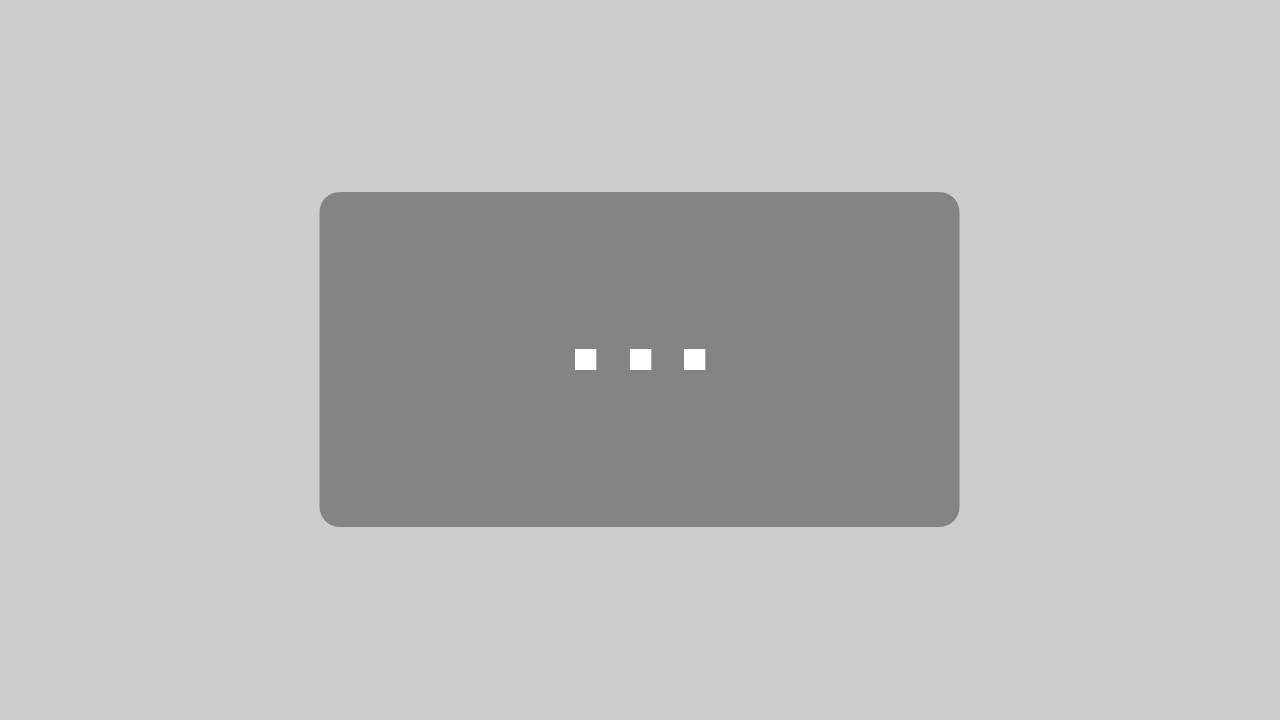Wie funktionieren bispezifische Antikörper?
In diesem Video geht es um bispezifischen Antikörper. Auf diesem Gebiet ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der Therapien. Herr Professor Salih ist am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg tätig und ist der Ärztliche Direktor der Translationalen Immunologie am Universitätsklinikum in Tübingen.
Keine Lust zu lesen? Hier sind alternative Medien:
Sie forschen im Bereich der Translationalen Immunologie?
Das ist richtig. Die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung der immunologischen Forschung sollen möglichst schnell zur Anwendung beim Patienten gebracht werden.
Ist die neue Therapie mit bispezifischen Antikörpern schon in der Anwendung?
Die Idee von den bispezifischen Antikörpern ist gar nicht so neu. Wie all die neuen Immuntherapien, die in den letzten zehn Jahren die Onkologie revolutionierten, wurden die bispezifischen Antikörper schon im letzten Jahrhundert, Ende der 80er Jahre konzipiert. Aber dass sie zur Anwendung beim Patienten gebracht werden, ist relativ neu.
Bis vor kurzem gab es nur einen einzigen Antikörper, der für die akute lymphatische Leukämie eingesetzt wurde. Mittlerweile gibt es weitere bispezifische Antikörper für den Lymphknotenkrebs. Monoklonale Antikörper gibt es schon länger. Aber bispezifische gibt es nicht mal eine Handvoll die verfügbar sind und auch nur für Blutkrebs. Die Herausforderung ist, sie auch für Patienten mit soliden Tumoren verfügbar zu machen.
Was ist das Besondere an den bispezifischen Antikörpern?
Die bispezifischen Antikörper können die potentesten, stärksten und klügsten Zellen des Immunsystems stimulieren. Das können die monoklonalen Antikörper nicht. Mit diesen bispezifischen Antikörpern kann man zwischen den Krebszellen und den T-Zellen gewissermaßen eine Brücke schlagen.
Bi – weil sie einen Zielarm haben, mit dem sie die Tumorzellen erkennen und mit ihrem zweiten Arm die T-Zelle greifen, an den Tumor heranführen und sagen: Greif an (was sie leider von alleine nicht gemacht hat), aktiviere sie und dann töten die T-Zellen die Tumorzellen ab.
Gehört das zu den zielgerichteten Therapien?
Wenn das Immunsystem stimuliert wird, muss man aufpassen, dass es nicht zu stark aktiviert wird, weil es dann Probleme gibt und das ist gefährlich. Deshalb haben die bispezifischen Antikörper die Eigenschaft, dass sie Ziel-Zell-restringiert funktionieren. Erst wenn sie die Tumorzellen gebunden haben, dürfen sie die T-Zelle aktivieren.
Wenn Sie die Tumorzellen nicht gebunden haben (an allen möglichen Stellen im Körper, wo sie auch sind), dürfen sie keinesfalls die T-Zellen stimulieren, weil die T-Zellen so potent sind. Wenn das passieren würde, gäbe es starke Nebenwirkungen.
Das sind also zielgerichtete Therapien, in dem Sinn zielgerichtet, dass sie die T-Zellen gezielt aktivieren, wenn sie die Tumorzellen erkannt haben.
Vorteil gegenüber der Chemotherapie
Der große Vorteil ist, dass im Gegensatz zu der Chemotherapie, bei der man auf alles „ballert“, was sich schnell teilt, ganz konkret die Tumorzellen in irgendeiner Form erkannt und genau adressiert werden.
Die Immunologen finden schon immer, dass die Immuntherapie die bessere ist. Ich arbeite seit 25 Jahren daran. Mein akademischer Vater hat die ersten bispezifischen Antikörper schon vor 35 Jahren beschrieben. Die sollen, wie Paul Ehrlich schon vor über 100 Jahren gesagt hat, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Das soll spezifisch dahin gehen, woran es binden soll und dann speziell aktivieren und nicht wie die Chemotherapie breit alle Zellen treffen.
Für welche Patienten ist die Therapie geeignet?
Gibt es Restriktionen bezüglich des Alters oder welche Therapien man vorher gemacht haben muss oder vorher nicht gemacht haben sollte?
Bei der Chemotherapie trifft man auch gesunde Zellen. Deshalb würde man die Immuntherapie idealerweise so früh wie möglich einsetzen, also VOR der Chemotherapie. Es ist aber so, dass man neue Therapien erst anwenden darf, wenn die bisher verfügbaren Therapien ausgeschöpft sind, da man nicht weiß, ob die neuen funktionieren. Deshalb darf man im Allgemeinen Immuntherapien erst NACH der Chemotherapie machen, was bedauerlich ist.
Wenn die Therapien in zehn oder 20 Jahren nicht mehr neu sind, könnte man sich vorstellen damit zu starten?
Ja. Hierfür haben wir ein Musterbeispiel: Die Checkpoint-Inhibitoren, eine Immuntherapie, die wir bei Lungenkrebs, Hautkrebs, Nierenkrebs und anderen sehr erfolgreich einsetzen. Die haben auch in der späten Therapielinie angefangen und haben sich inzwischen, weil sie so gut funktionieren, nach vorne gearbeitet und sind jetzt die erste Therapie. Wir hoffen, dass wir mit den bispezifischen Antikörpern auch bald dort ankommen.
Gibt es Restriktionen bezüglich des Alters?
Wenn diese Antikörper richtig funktionieren, sollen sie ganz gezielt nur das Immunsystem aktivieren. Und somit sollten idealerweise kaum Nebenwirkungen auftreten. Wenn das Immunsystem aktiviert wird, bekommt man manchmal ein bisschen erhöhte Temperatur. Dagegen haben wir auch gar nichts. Es darf nur nicht zu viel sein.
Aber wenn ein Patient so krank ist, dass er diese grippeähnlichen Symptome nicht aushalten könnte, haben wir ein Problem. Ansonsten können ALLE die Therapie machen und sollen in Zukunft auch alle profitieren.
Was ist ein Antikörper und was macht er normalerweise?
Antikörper haben wir alle im Blut. Antikörper sind ein Teil des Immunsystems, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Erkennen ihr Antigen, eine Eiweißstruktur, üblicherweise auf Bakterien auf Viren, binden daran und aktivieren dann das Immunsystem, um diese Feinde zu eliminieren.
Was machen Sie bei der Covid-Impfung? Sie geben einen Impfstoff und der führt dazu, dass das Immunsystem Antikörper bildet, die das SARS-COV2-Virus erkennt und eliminieren kann. So funktionieren normalerweise Antikörper. Nahezu alle Impfungen aktivieren Antikörper. Wir haben das im Körper. Und das Schöne ist, dass diese Antikörper spezifisch funktionieren. Wenn uns kein SARSCOV2-Virus befällt, schwimmen die Antikörper im Blut und machen nichts. Sie funktionieren Ziel-Zell-restringiert. Das ist die Funktionsweise eines Antikörpers.
Das Problem aber ist, dass die natürlichen Antikörper die potentesten Zellen des Immunsystems (T-Zellen) nicht aktivieren können, sondern nur das angeborene Immunsystem, die erste Verteidigungslinie. Für die potenten, klugen, schlauen Denker und Lenker des Immunsystems müssen wir die Antikörper gentechnisch künstlich herstellen, damit sie bispezifisch sind und einen Ziel- und einen Effektorarm haben.
Bildlich gesprochen: Man fährt mit einem Schiff in den Hafen und wirft ein Seil aus, um anzudocken. Die Antikörper sind quasi das Seil, mit dem man andocken kann. Mit dem ersten Arm wird das Seil ausgeworfen und bindet an die Tumorzellen. Aber nur weil das Boot jetzt angebunden ist, passiert noch nichts. Deshalb brauchen diese Antikörper neben dem Seil, welches nur bindet, den zweiten Arm, der nicht nur bindet, sondern aktiviert. Und zwar gezielt aktiviert. Erst wenn der erste Arm gebunden hat, nimmt der andere Arm die T-Zelle und sagt nicht nur: Komm her und bindet sie an, sondern sagt: Leg los. Greif an. Töte die Tumorzellen.
Ein weiteres Bild, dass die Situation verdeutlicht: Wenn man einen großen Tresor öffnen muss, gibt es zwei Personen, die einen Schlüssel haben. Wenn der eine seinen Schlüssel steckt, geht der Tresor nicht auf. Aber wenn der zweite seinen Schlüssel auch noch steckt und dreht, dann geht der Tresor auf. Ein Antikörper hat zwei Arme, zwei Schlüssel und nur wenn beide Schlüssel drehen/aktivieren, kommt es zu der Immunreaktion.
Und das muss sichergestellt werden, damit man keine oder wenig Nebenwirkungen hat. Weil sonst wird man quasi einen Amoklauf des Immunsystems auslösen, der dann extrem gefährlich wäre.
Ein Arm macht an der T-Zelle fest. Gibt es Menschen, bei denen der Arm die T-Zelle nicht erkennt?
Jede einzelne T-Zelle hat nur ein bestimmtes Ziel. So funktioniert sie natürlich, darum braucht sie auch keine Antikörper, da diese die T-Zellen nicht aktivieren können, weil die ganz spezifisch ein Eiweißmolekül erkennen.
Die bispezifischen Antikörper überbrücken das. Die binden an die Tumorzellen und dann nicht an die spezifische Eigenheit der T-Zelle, sondern an einen aktivierenden Rezeptor, der natürlich so nicht aktiviert werden kann. In der Natur ist das nicht vorgesehen, aber unser Antikörper bindet an eine Struktur, die alle T-Zellen (bei allen Menschen) haben.
Die T-Zelle weist das Merkmal CD3 auf. Und genau an dieses CD3 bindet dieser Antikörper. Das Merkmal haben alle T-Zellen bei jedem Menschen.
Schwieriger ist die andere Seite. Der Tumor muss auch das Merkmal haben. Aber im Prostatakarzinom ist es so, dass alle Patienten auch das Zieleiweißmolekül exprimieren, das sogenannte PSMA (Prostata-Spezifisches-Membran-Antigen).
Wie bekomme ich die Antikörper?
Die natürlichen Antikörper schwimmen im Blut herum. Die künstlichen Antikörper sind Eiweißmoleküle. Die kann man nicht schlucken, weil die Magensäure sie sofort kaputt machen würde. Die muss man als Infusion bekommen. Da gibt es unterschiedliche Applikationsweisen. Man kann es als Infusion über die Vene über zwei Stunden bekommen. Man kann es über 24 Stunden bekommen. Man kann es auch subkutan, also unter die Haut gespritzt bekommen, aber als Tablette geht es nicht, weil die Magensäure es kaputt machen würde.
Die bispezifischen Antikörper, die wir fürs Prostatakarzinom einsetzen, verabreichen wir als Kurzinfusion (Infusion über die Vene über wenige Stunden).
Wie häufig bekommt man die Infusion?
In unserer Studie verabreichen wir den Antikörper zunächst drei Tage. Es gibt zwei Testdosen, eine ganz niedrige, um zu sehen, ob der Patient allergisch reagiert (was er eigentlich nie tut). Eine zweite noch ein bisschen höhere, damit der Körper sich langsam an die Immunaktivierung gewöhnen kann. Dann haben wir unsere Zieldosis. Bei der Zieldosis bleibt man die ersten drei Tage stationär, dass nichts passiert, und danach erfolgt die Gabe ambulant. Der Patient kommt zweimal die Woche in einem Zeitraum von drei Wochen, bekommt seine Infusion und geht wieder nach Hause.
Wie geht es mit den Antikörpern weiter?
Die Antikörper sind dann im Blut und machen ihren Job, docken an und aktivieren die T-Zellen damit die Tumorzellen zerstört werden können. Bleiben diese Antikörper oder lösen sie sich auf oder werden sie aufgebraucht?
Im Prinzip geht es mit denen weiter wie mit den natürlichen Antikörpern. Die werden zum Teil über die Niere ausgeschieden, zum Teil werden sie verbraucht, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Üblicherweise werden die überflüssigen Antikörper über die Niere ausgeschieden. Irgendwann sind sie dann alle wieder weg. Das geht relativ schnell. Es kommt auf die Dosis an, kommt auf die Menge von Tumor an, wie viel da gebunden ist, wie viel Antikörper frei ist. Aber im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass nach ein paar Tagen der Antikörper wieder weg ist. Darum müssen wir ihn auch zweimal die Woche geben, damit ausreichend Antikörper da ist.
Das machen wir über drei Wochen und dann machen wir eine Woche Pause und dann ist ein Zyklus vorbei.
Gibt es Nebenwirkungen wie bei der Chemotherapie?
Nein! Die Chemotherapie wirkt auf alle Zellen, die sich teilen. Am meisten sind das die Krebszellen, weil die sich unerwünscht sehr schnell vermehren. Aber natürlich vermehren sich auch die Haare und die Darmschleimhaut muss sich erneuern und da gibt es viele Nebenwirkungen.
Die Immuntherapie macht das nicht. Die funktioniert wie die Zauberkugeln, die Paul Ehrlich beschrieben hat, aus der Oper Freischütz, bei der der Protagonist seine Seele verkauft, und die Kugeln dafür bekommt. Mit denen schießt er und die treffen immer ganz genau ihr Ziel.
Die Substanz der Chemotherapie, die im Blut ist, die schadet allem, was sich teilt. Der Antikörper tut gar nichts, außer er hat sein Ziel gefunden und die T-Zelle gebunden. Man hat also keine Auswirkungen auf die Blutbildung, keinen Haarausfall etc. Es gibt auch keine Nebenwirkungen wie bei der Hormontherapie, die man zum Beispiel beim Prostatakarzinom einsetzt. Da verliert man Muskeln und ist schlapp. Vielleicht erscheint das auf den ersten Blick nicht so schlimm wie die Nebenwirkungen der Chemotherapie, aber wenn den Männern das männliche Sexualhormone genommen wird, nimmt man ihnen, was sie zu Männern macht. Sie verlieren ihre Muskeln und sind nicht leistungsfähig. Die Patienten leiden da sehr darunter.
Bei unserer Therapie wird das Immunsystem aktiviert, dadurch bekommt man etwas erhöhte Temperatur, das dauert ungefähr zwei Stunden und das war’s dann.
Gibt es schon bekannte Langzeitfolgen der Therapie?
Bei der Therapie mit bispezifischen Antikörpern kann es keine Langzeitfolgen geben. Es kann immer etwas passieren, was man nicht erwartet, aber es ist schwer vorstellbar und auch nicht beschrieben. Denn wenn der Antikörper wieder weg ist, kann er nichts mehr machen.
Das klingt alles perfekt: Warum sollte das jemals nicht funktionieren?
Weil die Biologie schwierig ist. Man muss sich einmal überlegen, wie Tumoren entstehen. In jedem von uns entarten täglich viele Zellen. Man spricht von 20.000 Zellen am Tag, die entarten, also zu potenziellen Krebszellen werden können und das Immunsystem hält diese in Schach, eliminiert die in jedem von uns, die wir kein Krebs haben.
Irgendwann geht es schief und eine Zelle ist so entartet, dass das Immunsystem sie nicht kontrollieren kann. Und dann entwickelt sie sich weiter und passt sich so an, dass die Tumorzellen der Immunüberwachung entkommen. Die schlimmste Tumorzelle hat sich durchgesetzt, das Immunsystem sieht sie nicht mehr.
Jetzt wollen wir dem Immunsystem sagen: Du hast es allein nicht geschafft, deshalb helfen wir mit den bispezifischen Antikörper. Aber diese Tumorzellen sind natürlich unglaublich trickreich. Und wenn sie es trotzdem schaffen, sich der auch von uns induzierten Immunantwort zu entziehen, dann versagt die Therapie. Aber die bispezifischen Antikörper sind sehr neu. Die Erfolge, die die Immuntherapie jetzt erzielt, sind groß.
Wird es immer bei jedem Patienten funktionieren?
In der Medizin gibt es kein immer. Und es gibt in der Medizin nicht Jeder. Aber wir glauben durchaus, dass wir beim Großteil der Patienten etwas erreichen können.
Was im Körper passiert, sehe ich wie ein Krieg. Das Immunsystem sind die weißen Ritter, und die Tumorzellen sind die schwarzen Ritter. Und die ziehen jetzt in die Schlacht. Wenn Sie den weißen Rittern eine bessere Waffe geben (im Mittelalter den Langbogen zum Beispiel), werden sie gewinnen. Aber nur, wenn die Schwarzen nicht unendlich viele sind.
Bei einem Patienten mit einer weit fortgeschrittenen Tumorerkrankung sind die Tumorzellen sehr viele gegen relativ wenige Immunzellen. Da wird es schwierig.
Deshalb freuen wir uns über das, was wir jetzt beim Prostatakarzinom anbieten können. Hier führen wir eine Studie durch im sogenannten biochemischen Rezidiv des Prostatakarzinoms. Als Patient wurde man mit einem Prostatakarzinom diagnostiziert, wurde operiert oder bestrahlt und der Tumor ist eigentlich weg. Dann wird das sogenannte PSA (Prostata spezifische Antigen) gemessen und beobachtet. Wenn die Prostata weg ist und der Krebs weg ist, ist das PSA null. Bei vielen Patienten steigt der PSA-Wert aber leider wieder an. Und nachdem der gestiegene Wert nur von Tumorzellen kommen kann, ist klar, dass es sich um ein biochemisches Rezidiv handelt. Wir sehen den Tumor noch nicht, aber wir wissen, dass er wieder kommt.
Die Zahl der Tumorzellen (schwarzen Ritter) ist in dieser Situation sehr niedrig. Und deshalb können wir bei dieser niedrigen Tumorlast die bispezifischen Antikörper in der ersten Behandlungslinie verabreichen, also vor der Chemo- oder Immuntherapie. Und da hoffen wir, da gibt es ein oder zwei Schuss sozusagen, und dann sind die wenigen Zellen eliminiert. Das ist die Idee dieser Studie. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir die anbieten können.
Zahlen die Krankenkassen die Therapie oder geht das nur im Rahmen einer Studie?
Wir wissen nicht, ob die Therapie funktioniert. Deshalb führen wir eine klinische Studie durch, um festzustellen, ob dieser Therapieansatz erfolgreich sein wird. Wir sind sehr zuversichtlich, aber das muss mit Studien belegt werden und erst wenn man Phase 1 Studien, Phase 2 Studien und Phase 3 Studien gemacht hat, kommt es zu einer Zulassung und dann bezahlen das die Krankenkassen.
So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind in der Situation, dass wir im biochemischen Rezidiv eine Erstlinientherapie anbieten können. Das bezahlt die Krankenkasse nicht, das bezahlt aber die klinische Studie, die wir durchführen. Jeder Patient, der für uns geeignet ist (wir prüfen bei jedem Patienten, ob er die Kriterien erfüllt) kann teilnehmen, ohne dass Kosten für ihn entstehen. Das zahlt dankenswerterweise die Universität und noch andere öffentliche Geldgeber.
Was mache ich, wenn ich an einer solchen Therapie interessiert bin?
Glücklicherweise organisieren sich die Universitätskliniken und Kliniken immer mehr, nicht zuletzt auch mit Patientenorganisationen (diese leisten den wichtigen Beitrag Informationen zu verbreiten).
Wenn Sie als Patient eine maligne Erkrankung haben, dann würde idealerweise Ihr behandelnder Arzt sagen: Wir diskutieren Ihren Fall in einem Tumorboard an einem Zentrum und entscheiden, welche verschiedenen Therapieoptionen es gibt.
Natürlich können sich Patienten auch von außen an uns wenden, und das tun auch viele. Viele Patienten sind aus naheliegenden Gründen interessiert zu erfahren, was man in seiner Erkrankung Neues tun kann. Sie googeln, schauen im Internet. Homepage des Universitätsklinikum Tübingen: https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/immuntherapiestudie-rezidiv-prostatakarzinom#
Da finden Sie die klinische Kooperationseinheit Translationale Immunologie. Dort sind unsere Studien aufgelistet.
Oder Sie schreiben eine E-Mail an Prof. Salih:
kketi@med.uni-tuebingen.de
Idealerweise schreibt der behandelnde Arzt eine E-Mail mit Informationen. Aber auch die Patienten selbst können sich an uns wenden. Wir machen eine erste Prüfung und wenn es so scheint, als ob der Patient geeignet wäre, stellt sich der Patient bei uns vor.
In wie vielen Jahren könnte diese Therapie etabliert sein?
Die Medikamenten-Entwicklung dauert lang. All die Konzepte, die seit zehn Jahren die Onkologie revolutionieren, wurden schon Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelt. Es dauert leider im Durchschnitt 20 Jahre, bis ein Medikament entwickelt ist.
Aber viel von dem Weg haben wir bereits zurückgelegt. Und wenn wir unsere Studie erfolgreich abschließen können und sehen, dass das Ganze erstens sicher ist und zweitens erste Hinweise auf Effektivität zeigt, sind es leider trotzdem noch 5 bis 10 Jahre, bis die Therapie breit verfügbar ist.
Man weiß es nicht, aber wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt schon den Patienten anbieten können. Und jeder Patient, dem wir etwas Gutes tun können, ist es wert und jeder ist ein Erfolg.